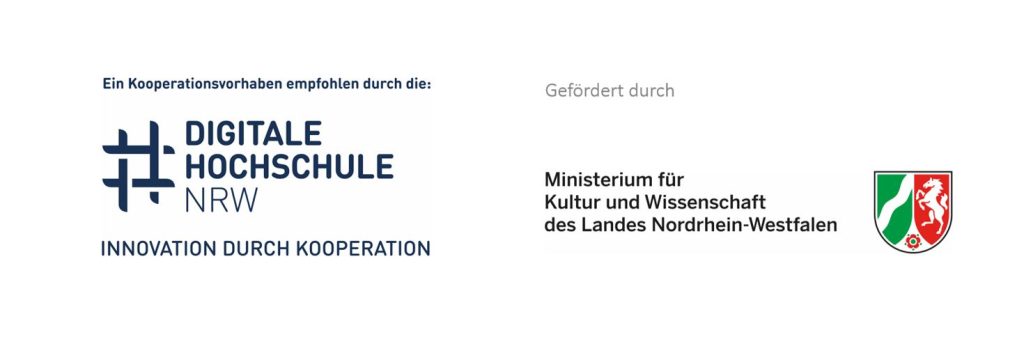Welche Geschäftsmodelle für Diamond Open Access Publikationen gibt es abseits der oft diskutierten[1] Article Processing Charges (APCs) und Book Processing Charges (BPCs)?
Dieser Blogartikel stellt Geschäftsmodelle[2] für Diamond Open Access (OA) Publikationen geordnet nach Zeitschriften, Infrastruktur und Büchern vor. Der Post ist inhaltlich in vier Teile gegliedert:
- Aktuelle Relevanz von Diamond OA Publikationen
- Tendenz zur Kategorisierung von Geschäftsmodellen
- Überblick der Geschäftsmodelle und Praxisbeispiele
- Erhöhte Transparenz und Klarheit in der Anwendung von Geschäftsmodellbezeichnungen.
Dieser Blogpost richtet sich an Wissenschaftler:innen und Bibliothekar:innen. Er ist an die Wissenschaftler:innen adressiert, die sich fragen: Wie kann ich die Kosten für meine Open Access Publikation (Zeitschrift/Buch) abdecken? Für Bibliothekar:innen kann dieser Artikel eine Hilfe sein, wenn sie sich zu dem Thema weiterbilden wollen und vor folgenden Fragestellungen in Beratungssituationen mit „ihren“ Wissenschaftler:innen stehen: Welches bzw. welche Geschäftsmodelle sind für das Publikationsvorhaben der Wissenschaftler:innen geeignet? Wohin kann die Reise (mit nachhaltiger Perspektive) gehen?
Wieso der Fokus auf Geschäftsmodelle abseits von APCs/BPCs?
Auf (hochschul-)politischer Ebene sowie im bibliothekarischen Raum gibt es einen zunehmenden Trend: Diamond Open Access Publikationen unterstützen. Diamond Open Access heißt in erster Linie, dass Autor:innen keine Gebühren für die Publikation ihrer Artikel zahlen.[3] In Deutschland nähert sich der Wissenschaftsrat in seiner 2022 verabschiedeten „Empfehlung zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access“ dem Thema an und weist darauf hin: „Diamond-Open Access bringt den Vorteil mit sich, dass die finanzielle Ausstattung der Institutionen von Autorinnen und Autoren keinen Einfluss auf die Publikationsgelegenheiten hat“ (Wissenschaftsrat 2022, 23).
Auch auf Förderebene hat das Thema Eingang gefunden, so hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2024) im letzten Jahr eine Servicestelle „Neue Dynamik bei Diamond Open Access“ ausgeschrieben, die zum Mai 2025 ihre Arbeit aufnimmt (SeDOA o.D.). Demmy Verbeke (2022), Associate Professor of Open Scholarship an der KU Leuven, sieht Bibliotheken in der Verantwortung, Möglichkeiten für die Finanzierung von Diamond OA zu finden. Der Wissenschaftler schlägt dafür folgenden Weg vor: “if libraries want to financially support Diamond OA, they need to either prioritize it in the sense that they first spend available budget on Diamond OA, then on paywalled content, then on for-profit OA“. Diese Aussage steht für eine bereits weitreichendere Diskussion im hochschul- und bibliothekarischen Raum rund um Kriterien in der Finanzierung zur Realisierung von Diamond OA. Sie fokussiert sich nicht auf die Definition von Diamond OA oder ob Diamond OA wünschenswert ist. Auf dieser Argumentationsebene wird davon ausgegangen, dass Diamond OA eine Antwort auf Probleme liefert, die u.a. durch das Geschäftsmodell APCs/BPCs entstehen. Die Frage, die es nun zu beantworten gilt, ist: Wie kann die Finanzierung in der Realität sowie im Detail von Bibliotheken gestemmt werden? (siehe in diesem Zusammenhang auch Barnes and Grady 2023a, 2023b).
Mit Fokus auf redaktionelle Tätigkeiten wird in der Literatur festgehalten: Essentiell für das Bestehen von Diamond Open Access Publikationen sind „ehrenamtliches Engagement“ (Keller 2017, 32) und personelle Ressourcen sowie Nachfolger, die in die Fußstapfen der Herausgeber:innen treten, um das Überleben des Formats über mehrere Jahre zu sichern. Die Finanzierung sollte also im besten Fall nachhaltig und unabhängig von Einzelpersonen gestaltet sein (Ganz, Wrzesinski, Rauchecker 2019; Waidlein et al. 2021).
Bestrebungen zur Klassifizierung bzw. Kategorisierung von OA-Geschäftsmodellen
Seit einigen Jahren sind immer mehr OA-Geschäftsmodelle auf den Markt gekommen (Barnes and Grady 2023a). Im bibliothekarischen Raum gibt es mehrere Versuche, der Vielfalt an Geschäftsmodellen durch eine Klassifizierung bzw. Kategorisierung beizukommen – oder wie Mellins-Cohen (2024) es ausdrückt: “many of us are looking at the plethora of open access business models and trying to make sense of the ever-increasing list of options.“ Die Publikationsberaterin stellt ein Klassifizierungssystem mit sieben Kategorien von Geschäftsmodellen vor. Basis dafür ist ihre eigene jahrelange Arbeit in dem Feld (Mellins-Cohen 2024). Weitere Autor:innen, die sich der Kategorisierung von Geschäftsmodellen widmen, sind Lair (2021), Kändler (2020) sowie Penier, Eve und Grady (2020). Sie eröffnen zwei, drei und vier Kategorien, um die derzeitige Komplexität von Modellen zu reduzieren. Die Herangehensweisen sind dabei unterschiedlich. Bei Kändler (2020, 182) und Penier, Eve und Grady (2020, 10) sind die Kategorien abgeleitet von der Sicht des Akteurs, der die Finanzierung bereitstellt. Kändler (2020, 182) fasst dies unter „‘wer zahlt?‘“ zusammen. Bei Lair (2021) spielt die Dauer der Zahlung eine Rolle: „One-Time Spend“ und „Ongoing Spend“. Andere Beiträge zum Thema sortieren die Geschäftsmodelle nach „Zeitschriftentyp“ (Keller 2017, 33) sowie nach „journal scenarios“ (Waidlein et al. 2021, 9), ganz nach dem Motto: Welches Geschäftsmodell ist das richtige für welche Art von bzw. welchen Entwicklungsstand einer Zeitschrift?
Insgesamt ist festzustellen: Es gibt Kategorisierungen von Geschäftsmodellen, die Geschäftsmodelle an sich und Praxisbeispiele für ein Geschäftsmodell. Diese Unterscheidung soll im nächsten Teil dieses Blogartikels aufgegriffen werden, in dem ein systematischer Überblick über Modelle aufgestellt wird.
Überblick zu Geschäftsmodellen abseits von APCs und BPCs
Dieser Teil des Artikels stellt verschiedene Geschäftsmodelle vor, die für Autor:innen im Zusammenhang mit Diamond Open Access-Zeitschriften, -Büchern und -Infrastruktur praktikabel sind. Es sollen vor allem solche Geschäftsmodelle abseits von APCs/BPCs beleuchtet werden, die für Wissenschaftler:innen nicht so geläufig sein dürften. Das heißt Modelle abseits von der Einwerbung von „Drittmitteln“ (Keller 2017, 32), dem Einbezug von „Stellenanteilen“ (Ganz, Wrzesinski, Rauchecker 2019) oder der Veräußerung von „institutionellen Geldern“ (Keller 2017, 32) sowie Publikationsfonds (Ganz, Wrzesinski, Rauchecker 2019; Keller 2017, 32) und Druckausgaben (open-access.network 2024a).
Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Diamond OA-Geschäftsmodelle. Sie kann von links nach rechts gelesen werden. Die Angaben in der Tabelle zu den Namen der Geschäftsmodelle (bis auf Konferenzteilnahmegebühren) wurden auf Basis der Analyse der gängigen und bekannten Quellen zusammengestellt. Quellenangaben zu Praxisbeispielen, wenn vorhanden und nicht selbstständig recherchiert bzw. aus der eigenen praktischen Arbeit abgeleitet, werden an entsprechender Stelle aufgeführt.
Zunächst wird der Name des Geschäftsmodells wiedergegeben. In den drei Spalten darauf ist erkennbar, ob das Geschäftsmodell Eingang im Bereich Zeitschriften, Bücher und Infrastruktur gefunden hat und welche Beispiele es aus der Praxis für das Modell gibt. Unterhalb der Tabelle erfolgt ein Textabschnitt, der die Geschäftsmodelle bzw. Modellnamen erläutert und voneinander differenziert. An dieser Stelle soll angeführt werden, dass zur Realisierung eines Publikationsvorhabens meist auf mehr als ein Geschäftsmodell zurückgegriffen wird (Kändler 2020, 183; open-access.network 2024a; Penier, Eve, Grady 2020; Speicher et al. 2018).
| Name des Geschäfts-modells | Zeitschriften: Praxisbeispiele | Bücher: Praxisbeispiele | Infrastruktur: Praxisbeispiele |
| Crowdfunding, individuell | Open Library of Humanities (OLH) (open-access.network 2024a, b; Waidlein et al. 2021, 194), unglue.it (Keller 2017, 28), Knowledge Unlatched (Kändler 2020, 193; Oberländer und Dreher 2019, 10), Verfassungsblog | De Gruyter (Penier, Eve und Grady 2020, 17), unglue.it (OA Books Toolkit 2020; Penier, Eve und Grady 2020, 17) | Open Library of Humanities (OLH) als Publikations-plattform |
| Freemium | OpenEdition (Journals) (Keller 2017, 31; open-access.network 2024b) | OpenEdition (Books) (open-access.network 2024a; Penier, Eve und Grady 2020, 23), Open Book Publishers (open-access.network 2024a; Speicher et al. 2018, 7), punctum books (OA Books Toolkit 2020), OECD (Publishing) (OA Books Tookit 2020; Penier, Eve und Grady 2020, 23) | OpenEdition als Publikations-plattform |
| Konferenzteil-nahmegebühren | Dagstuhl Publishing | ||
| Konsortial/Konsortium (institutionelles oder bibliotheka-risches Crowdfunding) | SCOAP³ (Keller 2017, 29; open-access.network 2024b), KOALA (open-access.network 2024b), Open Library of Humanities (OLH) (Kändler 2020, 194-195; Keller 2017, 29; Oberländer und Dreher 2019, 15), edu_consort_oa, OLEcon | KOALA (OA Books Toolkit 2020, open-access.network 2024a), OAdine (open-access.network 2024a), TOAA (open-access.network 2024a), edu_consort_oa, Knowledge Unlatched (Mackay 2021; OA Books Toolkit 2020), De Gruyter (OA Books Toolkit 2020), OAPEN (Speicher et al. 2018, 9) | Preprint-Server arXiv (Kändler 2020, 195; open-access.network 2024a), OAPEN als Publikationsplattform |
| Liberation | MIT Press (Penier, Eve und Grady 2020, 36) | ||
| Sponsoring | bfo-Journal (Keller 2017, 28), Other Voices (Keller 2017, 28) | DOAJ (Keller 2017, 29) | |
| Subscribe to Open | Annual Reviews (Kändler 2020, 196; Oberländer und Dreher 2019, 9; open-access.network 2024b) | Berghahn Books (Kändler 2020, 196; Oberländer und Dreher 2019, 9), Opening the Future (Mackay 2021), MIT Press (OA Books Toolkit 2020) | |
| Werbung | British Medical Journal (Keller 2017, 28) | Bookboon (Penier, Eve und Grady 2020, 12) |
Quellen: Kändler 2020; Keller 2017; Mackay 2021; OA Books Toolkit 2020; Oberländer und Dreher 2019; open-access.network 2024a; open-access.network 2024b; Penier, Eve und Grady 2020; Speicher et al. 2018; Waidlein et al. 2021.
- Crowdfunding, individuell: Die Beschreibung des OA Books Toolkit (2020) des Crowdfunding ist einfach und klar: “Individuals pledge fees to make a book open access; once enough individuals have confirmed participation and the target amount is achieved, the book is made open access.” Der Fokus auf der Finanzierung durch Individuen wird auch von Penier, Eve und Grady (2020, 17) aufgegriffen. Die Autor:innen unterscheiden individuelles von institutionellem Crowdfunding. Letzteres gehört für sie zur konsortialen Förderung bzw. zum konosortialen Modell (Penier, Eve und Grady 2020, 26). Crowdfunding findet über einen abgesteckten Zeitraum (Kändler 2020, 193) und teils über die Plattform von externen Betreibern statt (Waidlein et al. 2021, 14).
- Freemium: Hinter diesem Namen steht der Zustand „online version free“ (Speicher et al. 2018) oder wie Keller (2017, 31) es ausdrückt: „Das Modell kombiniert die zwei Aspekte ‚free‘ und ‚premium‘.“ Dabei handelt es sich nicht unbedingt, um eine PDF-Version, sondern eine schmucklosere Herausgabe, wie beispielsweise die Publikation im HTML-Format (Penier, Eve und Grady, 22; Waidlein et al. 2021, 15).
- Konferenzteilnahmegebühren: Auch dieses Modell bleibt bisher in der Literatur unerwähnt. Von den Organisator:innen der Konferenz wird eine Gebühr erhoben, von der dann eine Konferenzzeitschrift publiziert wird. Gebühren für Autor:innen fallen nicht an (siehe Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) von Dagstuhl Publishing aus Deutschland).
- Konsortial/Konsortium (institutionelles oder bibliothekarisches Crowdfunding): Durch die Unterscheidung des konsortialen Geschäftsmodells von dem Modell des Crowdfunding wird gleichzeitig auch erkennbar, was hinter dem Begriff steht. Das konsortiale Modell „is very similar to crowdfunding, except that it is not private individuals who provide money but public institutions or financially-stable private research institutions” (Waidlein et al. 2021, 16). Penier, Eve und Grady (2020, 36) nennen dieses Modell „library crowdfunding“. Das OA Books Toolkit (2020) nutzt den Begriff “library consortium” bzw. “institutional crowdfunding”.
- Liberation: Laut des Autorenteams Penier, Eve und Grady (2020, 35), dass sich auf Bücher fokussiert, handelt es sich hier um ein Modell, bei dem bereits erschienene (Backlist) Titel verfügbar gemacht werden: „Sponsors (foundations or governments) buy the copyright for books and then make them OA. Sponsors can also provide the financing for presses to convert their backlists to OA.”
- Sponsoring: Dieses Geschäftsmodell wird in zwei Literaturquellen angeführt. Waidlein et al. (2021) sowie Keller (2017) sehen beide eine Parallele zum Crowdfunding. Beim Sponsoring sind die überwiesenen Summen jedoch höher (Waidlein et al. 2021, 14; Keller 2017, 28). Häufig wird auch der Name der Förderin/des Förderers (plakativ) genannt (Keller 2017, 28).
- Subscribe to Open: Dieses Modell ist gefühlt in aller Munde und wird derzeit in vielen Talks, auf Konferenzen und in Webinaren zu Open Access diskutiert. Bei diesem Modell gibt es unterschiedliche Definitionen für Bücher und Zeitschriften. Kändler (2020, 195) macht kurz und prägnant deutlich, was hinter der Bezeichnung im Zusammenhang mit Zeitschriften steht: “Das bisherige Subskriptionsvolumen nutzen und die Zeitschriften auf dieser finanziellen Basis im Open Access publizieren […].“ Für Bücher gilt laut des OA Books Toolkit (2020) folgendes: “Libraries subscribe to or purchase specified collections of closed-access books, which may include backlist titles. The subscription fees are used to fund open access for newly published books.“
- Werbung: Bei diesem Modell liegt der Fokus auf “selling advertising space on the journal’s homepage. In particular, advertising can provide income where the journal’s readership is specialised […]” (Waidlein et al. 2021, 12). Dieses Modell geht jedoch mit ein paar Schattenseiten einher. Es wird darauf hingewiesen, dass zu viel Werbung einen negativen Eindruck auf die Leserschaft bzgl. der Qualität des Publikationsformats haben kann (Penier, Eve und Grady 2020, 12) und Wissenschaftler:innen dies mit einem Einbußen ihrer Autonomie gleichsetzen könnten (Keller 2017, 28).
Die Tabelle zeigt eindrücklich, den oben bereits erwähnten Fakt, dass für eine Herausgeberschaft bzw. im Kontext eines Publikationsprojekts mehrere Geschäftsmodelle zum Tragen kommen können. Penier, Eve und Grady (2020) haben dies auch im Anhang ihrer Auseinandersetzung mit „Revenue Models for Open Access Monographs“ deutlich gemacht. So ist „punctum books“ ein Praxisbeispiel für sechs Geschäftsmodelle (Penier, Eve und Grady 2020, 50). Open Book Publishers wird in ihrer Tabelle in vier Geschäftsmodelle eingeordnet (Penier, Eve und Grady 2020, 49).[4]
Zu ergänzen ist aus publisher-Sicht eine interne Querfinanzierung/subsidy, die in der an Wissenschaflter:innen und (bibliothekarische/öffentliche) Förderer gerichteten Tabelle fehlt. Sie sollte dem Zielpublikum dieses Artikels aber bewusst sein als potentielle Einnahmequelle abseits des eingesetzten Geschäftsmodells: Besondere Dienstleistungen des Publishers aus seinem Angebotsportfolio werden in Rechnung gestellt als “supply-side model, in which funding for OA monographs comes from revenues from the publisher’s commercial activities such as service provision, institutional funding, sale of translation rights, or profits from other non-OA publications” (Penier, Eve, Grady 2020, 15). Auch Einkünfte aus dem Verkauf von Print-Exemplaren könnten aufgezählt werden. Dieses Modell wird beispielsweise vom britischen Verlag Open Book Publishers eingesetzt (Open Book Publishers o.D.).
Einheitliche und präzisere Begriffsverwendung von Geschäftsmodellen für die Zukunft
Es ist nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die Praxisbeispiele wie die Open Library of Humanities (OLH) oder Knowledge Unlatched von unterschiedlichen Autor:innen in verschiedene Geschäftsmodelle (individuelles Crowdfunding und Konsortium; siehe Tabelle) eingeordnet werden, nicht nur mit dem Mix dieser Modelle zur Finanzierung zusammenhängt, sondern auch für eine fehlende Trennschärfe in der Benutzung der Geschäftsmodellbezeichnungen spricht. Um die Aufklärungsarbeit in Bibliotheken (in Beratungssituationen mit Wissenschaftler:innen), zu den Modellen auf lange Sicht zu erleichtern und effizienter zu gestalten, ist daher eine einheitlichere Begriffsverwendung und -trennung in der Zukunft wünschenswert.
Zuletzt sollte eine Tatsache, die auf Konferenzen wie der BiblioCon2024 oder den OA-Tagen 2024 immer wieder betont wird, auch in diesem Artikel nicht außer Acht gelassen werden: Häufig werden Diamond OA Publikationen als „kostenlos“ dargestellt. Diese Aussage ist nicht richtig. Einige Argumente klangen bereits im ersten Teil dieses Blogposts an. Es stimmt, es fallen keine Gebühren im Sinne von APCs und BPCs an, dafür fließen aber weiterhin Kosten für Personal, Infrastruktur und zeitliche Ressourcen in das Publizieren von Diamond OA-Zeitschriften und -Büchern ein. Diese Mittel werden von Wissenschaftler:innen und, hier bedarf es einer Hervorhebung, in genauso hohem Maße von Bibliothekar:innen (z.B. OA-Beauftragten) erbracht. Der Punkt der „kostenlosen“ Diamond OA Publikationen sollte weiterhin diskutabel sein und gleichermaßen auf wissenschaftlicher sowie bibliothekarischer Seite mitgedacht werden sowie im besten Fall in gemeinsamen (Gesprächs-)Räumen debattiert werden.
Hinweis: Die Beispiele zu verschiedenen Geschäftsmodellen wurde angereichert durch eine Diskussion mit Erwerbungsleitungen der 42 DH.NRW Hochschulen im September 2024. Eine Zusammenfassung des Standes aus September liefert dieses Miro-Board: https://miro.com/app/board/uXjVKmykPts=/. Die Landesinitiative openaccess.nrw dankt den Beteiligten für die rege Diskussion und den Austausch!
Ancion, Zoé, Borrell-Damián, Lidia, Mounier, Pierre, Rooryck, Johan und Bregt Saenen (2022): Action Plan for Diamond Open Access. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403
Barnes, Lucy und Tom Grady (2023a): How can I persuade my institution to support collective funding for open access books? (Part One) <https://copim.pubpub.org/pub/3cjxkovk/release/3>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Barnes, Lucy und Tom Grady (2023b): How can I persuade my institution to support collective funding for open access books? (Part Two)
<https://copim.pubpub.org/pub/a5fcp0ij/release/3>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2024): Ausschreibung: Neue Dynamik bei Diamond Open Access. <https://www.dfg.de/resource/blob/324442/
db52a2a58f84c92b1c3d7cf9cb2eaf41/call-diamond-open-access-de-data.pdf>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Ganz, Kathrin, Wrzesinski, Marcel und Markus Rauchecker (2019): Nachhaltige Qualitätssicherung und Finanzierung von non-APC, scholar-led Open-Access-Journalen. In: LIBREAS. Library Ideas, 36. <https://libreas.eu/ausgabe36/ganz/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Kändler, Ulrike (2020): Open-Access-Finanzierung. In: Karin Lackner, Lisa Schilhan, Christian Kaier (Hg.): Publikationsberatung an Universitäten. Ein Praxisleitfaden zum Aufbau publikationsunterstützender Services. transcript Verlag: Bielefeld. 181-201.
Keller, Alice (2017): Finanzierungsmodelle für Open-Access-Zeitschriften. In: Bibliothek – Forschung und Praxis, 41 (1): 22-35.
Kowaltowski, Alicia J., Arruda, José R. F., Nussenzveig, Paulo A., und Ariel Mariano Silber (2023): Guest Post – Article Processing Charges are a Heavy Burden for Middle-Income Countries. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/03/09/guest-post-article-processing-charges-are-a-heavy-burden-for-middle-income-countries/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Lair, Sharla (2021): Open Access Book Programs: Answering Libraries’ Questions. <https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2021/10/27/open-access-book-programs-answering-libraries-questions/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Mackay, Caroline (2021): Supporting open access monographs without the costs of book processing charges. <https://research.jiscinvolve.org/wp/2021/08/10/supporting-open-access-monographs-without-the-costs-of-book-processing-charges/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Mellins-Cohen, Tasha (2024): Guest Post – Making Sense of Open Access Business Models. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2024/03/26/guest-post-making-sense-of-open-access-business-models/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Michael, Ann (2020): Sustainable Open Access – What’s Next?, <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/08/27/sustainable-open-access-whats-next/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
OA Books Toolkit (2020): Business models for OA book publishing. <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/10944589-planning-funding/article/10432084-business-models-for-open-access-book-publishing>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Oberländer, Anja und Lena Dreher (2019): Jenseits von APC: Überblick über alternative Open-Access-Modelle. Open-Access-Tage 2019, Hannover, Germany. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3490737
open-access.network (2024a): Geschäftsmodelle für Bücher. <https://open-access.network/informieren/finanzierung/geschaeftsmodelle-fuer-buecher>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
open-access.network (2024b): Geschäftsmodelle für Zeitschriften. <https://open-access.network/informieren/finanzierung/geschaeftsmodelle-zeitschriften>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Open Book Publishers (o.D.): Our business model.
<https://www.openbookpublishers.com/about/our-business-model>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Penier, Izabella, Eve, Martin Paul und Tom Grady (2020): COPIM – Revenue Models for Open Access Monographs 2020 (2.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4455511
Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA) (o.D.): Projektinformation. <https://diamond-open-access.de/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Speicher, Lara, Armando, Lorenzo, Bargheer, Margo, Eve, Martin Paul, Fund, Sven, Leão, Delfim, Mosterd, Max, Pinter, Frances und Irakleitos Souyioultzoglou (2018): OPERAS Open Access Business Models White Paper. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.1323708
Verbeke, Demmy (2022): Libraries and Diamond Open Access. <https://scholarlytales.hcommons.org/2022/04/13/libraries-and-diamond-open-access/>, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
Waidlein, Nicole, Wrzesinski, Marcel, Dubois, Frédéric und Katzenbach, Christian (2021): Working with budget and funding options to make open access journals sustainable. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4558790
Wissenschaftsrat (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. Köln. https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61, zuletzt abgerufen am 10.01.2025.
[1] In diesem Zusammenhang sind eine ganze Reihe von Autor:innen zu nennen, die Kritikpunkte an APCs in ihren Publikationen diskutieren: Ganz, Wrzesinski und Rauchecker 2019; Kändler 2020; Kowaltowski et al. 2023; Michael 2020. Dieser zweiteilige Artikel widmet sich den Nachteilen von BPCs: Barnes und Grady 2023a, 2023b.
[2] Derzeit werden verschiedene Bezeichnungen in der Literatur verwendet: „business models“ (OA Books Toolkit 2020), „financing models“ (Waidlein et al. 2021) oder „revenue models“ (Penier, Eve und Grady 2020). In Anlehnung an Kändler (2020) und das open-access.network (2024a, 2024b) wird in diesem Artikel der Begriff „Geschäftsmodell“ verwendet.
[3] Siehe hierzu beispielsweise die Definition im „Action Plan for Diamond Open Access“: „‘Diamond‘ Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers. Diamond Open Access journals represent community-driven, academic-led and -owned publishing initiatives.” (Ancion et al. 2022, 3)
[4] Siehe auch Waidlein et al. (2021, 17), die folgende Aussage über das Geschäftsmodell von OpenEdition Journals tätigen: „This platform not only provides a consortium in the humanities and social sciences but also combines funding with a so-called ‘Freemium-model’ (OpenEdition Freemium distribution programme).”