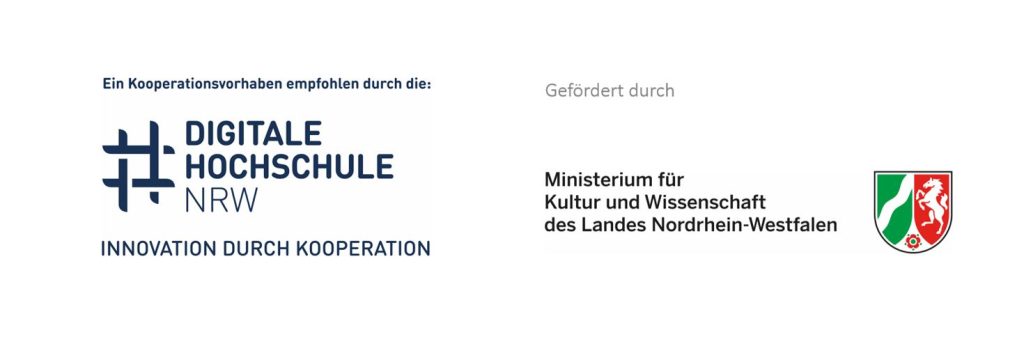Wie sehen Einsatzszenarien und Good Practices von OMP an DH.NRW Hochschulen aus?
Am 06.02.2025 haben Kolleg:innen des Hochschulbibliothekzentrums (hbz) über Kernfunktionen und Vorteile der Software Open Monograph Press (OMP) aufgeklärt. Die Veranstaltung fand digital von 11:00 bis 12:30 Uhr statt. Teilnehmer:innen wurde die Möglichkeit gegeben, praktische Einblicke sowie Vorteile in den Publikationsdienst von drei Hochschulen zu erhalten, die die Software einsetzen, und Fragen rund um das Thema einzubringen.
OMP-Serviceangebot des Programmbereich 2
Hintergrund der Veranstaltung ist das seit Januar geltende Angebot für Hochschulbibliotheken, institutionseigene OMP-Testinstanzen (Version 3.4) unverbindlich beim hbz in Anspruch zu nehmen. Seit Januar 2025 können staatlich geförderte NRW Hochschulen[1], die Teil der DH.NRW sind, das Portfolio ihrer Publikationsdienste um die OMP-Software der Entwicklercommunity Public Knowledge Project (PKP) erweitern. Die Open-Source-Software dient dazu, Open Access Bücher qualitätsgesichert online zu veröffentlichen. Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen übernimmt das hbz Hosting und Wartung der Software und berät die Hochschulbibliotheken bei der Einrichtung des Systems. Im Oktober wurde auf dem Blog der Landesinitiative das Angebot der Einrichtung einer zentralen OMP-Testinstanz vorgestellt[2], mit Hilfe derer Hochschulen die Software kennenlernen können.[3]
Sprecher:innen aus drei DH.NRW Hochschulen zu konkreten Einsatzszenarien
Nach einer Einführung in die Kernfunktionalitäten von OMP durch die Projektmitarbeiterin Anna Keller, stellten die Gäst:innen Niklas Spehl, Raphael Thiele und Pia Piontkowitz aus der Heinrich-Heine-Universität (HHU), der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) sowie der Ruhr-Universität Bochum (RUB) ihre jeweiligen Publikationsdienste basierend auf OMP vor. Die Häuser nutzen OMP bereits seit einigen Jahren als Teil ihrer lokalen Publikationsangebote. Die Publikationsplattformen der drei Hochschulen heißen:
Die Sprecher:innen gaben Einblicke in die bibliothekarischen Abläufe sowie ihre individuellen Erfahrungswerte mit OMP. In der Gegenüberstellung wurde deutlich, dass es in den Häusern u.a. Unterschiede in den Vorgaben zur Art der Verwendung der eingerichteten Plattform in Abhängigkeit zur Personaldecke wie auch individuell gestaltete Abläufe für Herausgeber:innen gibt.
Die vielfältigen Fragen aus dem Publikum konnten durch die Sprecher:innen und Organisator:innen beantwortet werden. Anforderungen, wie die kapitelweise DOI-Vergabe, sind in der OMP Version 3.4 möglich. Es können auch ISBN für Monographien und Sammelbände vergeben werden (anders als bei Repositorien). Teilweise laden die Bibliothekar:innen die Publikationen selbst in OMP hoch, teilweise werden Herausgeber:innen für den Zeitraum der Erarbeitung einer Monographie bzw. Sammelbandes berechtigt, selbstständig in OMP zu arbeiten. Entsprechend verfügen die Hochschulbibliotheken über individuelle Anforderungen an Herausgebende was den Reifegrad von Publikationen betrifft. Dies schließt z.T. auch inhaltliche Anforderungen ein, z.B. können in einem Fall nur Professor:innen in OMP publizieren, damit eine Qualitätssicherung im Sinne einer Reputation der Hochschule sichergestellt ist.
Die Bibliothekar:innen übernehmen im Allgemeinen Dienstleistungen hinsichtlich der Vergabe von DOI und ISBN, die Kontrolle von Metadaten, die Indexierung bei DOAB, bis hin zum Upload von bereits fertiggestellten Publikationen. Die Erstellung der Layouts von Publikationen bzw. CSS-Stylesheets zur Gestaltung von Landing Pages erfolgt in der Regel durch die Forschenden selbst. Insofern war auch die Frage relevant, ob die Publikationsdienste als Verlage aufgefasst werden könnten. Die Sprecher:innen betonten, dass sich die Bibliotheken in einer Grauzone bewegen, da bestimmte Arbeiten auf Grund der Personaldecke schlicht nicht übernommen werden können. Bibliothekarische Kernkompetenzen kommen aber durchaus zum Einsatz und sind Teil der jeweiligen Publikationsservices.
Rechtliche Beratung zu Kooperationsvereinbarungen zwischen Herausgebenden und Bibliothek
In der Abschlussdiskussion der Veranstaltung kam auch die Frage auf, ob oa.nrw Muster für Verträge bzw. Kooperationsvereinbarungen zwischen Bibliotheken und Herausgebenden anbietet. Das hbz stellt in seinem Servicewiki die von der FH Münster entwickelte Kooperationsvereinbarung zur Verfügung.[4] Diese Vereinbarung kann individuell angepasst werden. Bei der Konzeption der Vereinbarung oder für Rückfragen zur Formulierung steht die juristische Beratung der Landesinitiative zur Verfügung. Die neu erstellte Kooperationsvereinbarung muss aber in jedem Fall abschließend durch das Justiziariat und den/die Datenschutzbeauftragte/n der Hochschule freigegeben werden, bevor sie mit den Herausgebenden geteilt wird.
Sollte auch Ihre Einrichtung ein unverbindliches Interesse an einer OMP-Testinstanz haben, können Sie sich gerne unter openaccess@hbz-nrw.de melden. Mehr Informationen zum Angebot finden Sie auch im Service-Wiki des Programmbereichs 2 der Landesinitiative openaccess.nrw. Die Präsentation zur OMP-Infoveranstaltung und aller Beteiligten finden Sie unter diesem Link.
Bei Interesse an einer kostenfreien rechtlichen Beratung kontaktieren Sie die Landesinitiative gerne über das folgende Beratungsformular: https://openaccess.nrw/index.php/beratung/ .
Agenda:
- Einführung in die Kernfunktionalitäten vom OMP, Anna Keller (hbz)
- Vorstellung von OMP-Anwendungsfällen an der
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU), Niklas Spehl
- Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB), Raphael Thiele
- Ruhr-Universität Bochum (RUB), Pia Piontkowitz
- Fragen und Diskussion
[1] Die förderfähigen Hochschulen der DH.NRW kooperieren im Rahmen der Landesinitiative openaccess.nrw mit dem hbz, um die Services des Programmbereichs 2 auf Basis einer Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft bis mindestens zum 31.12.2025 an ihrer Hochschulbibliothek kostenfrei zu nutzen.
[2] Siehe Blogartikel „Neues Infrastrukturangebot für OA-Monographien der Landesinitiative openaccess.nrw“.
[3] Weitere Informationen hält das Service-Wiki des hbz bereit: https://service-wiki.hbz-nrw.de/spaces/OA/pages/1044447561/Open+Monograph+Press+OMP.
[4] Die Kooperationsvereinbarung zwischen Herausgebenden und der Bibliothek kann hier abgerufen werden: https://service-wiki.hbz-nrw.de/spaces/OA/pages/1027114283/Eine+OA-Zeitschrift+gr%C3%BCnden.